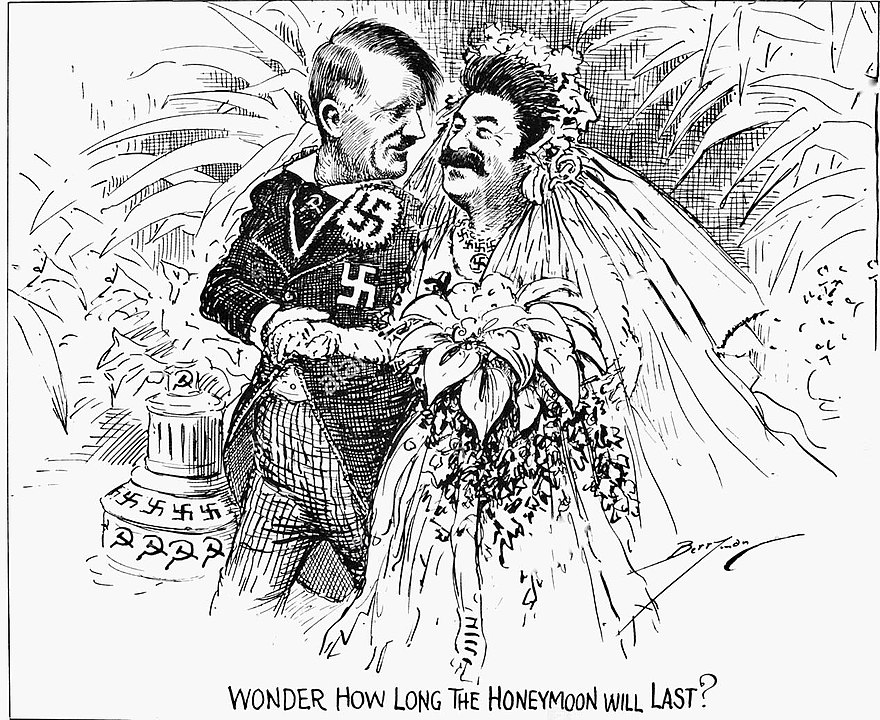Adolf Hitler hatte schon lange vor dem 1.9.1939 Pläne gefasst, einen Krieg zu entfachen, um Deutschland als Weltmacht zu etablieren. Das angestrebte "Großdeutsche Reich" sollte sich über Polen bis weit nach Russland erstrecken. Die nationalsozialistische Politik sah außerdem eine rassische Neuordnung innerhalb Europas vor. Die Nationalsozialisten wollten Minderheiten wie Juden oder Sinti und Roma auslöschen, um die "arische Rasse" aufzuwerten.
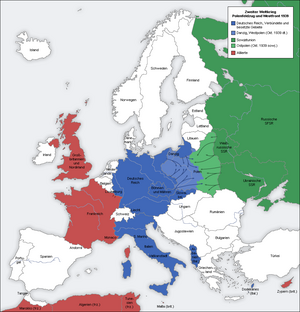
Hitlers Außenpolitik zielte zunächst
darauf ab, die politische Isolation Deutschlands nach dem
Ersten Weltkrieg zu überwinden. Vor den Augen der anderen
europäischen Mächte betrieb das Deutsche Reich vordergründig
Friedenspropaganda, tatsächlich jedoch sollte Deutschland
gezielt für den geplanten Krieg militärisch aufrüsten und
wirtschaftlich autark gemacht werden. Der Überfall auf Polen
war ein erster gewalttätiger Schritt der expansiven
deutschen Außenpolitik.
Schon am 3. Februar 1933 forderte Hitler in einer Geheimrede
vor den ranghöchsten Offizieren der Reichswehr, das Deutsche
Reich müsse neuen "Lebensraum im Osten" erobern und diesen
"rücksichtslos germanisieren". Deutschland sollte schnell
aufrüsten und wieder militärische Stärke erlangen. Den
Staaten, die durch die NS-Machtübernahme aufgeschreckt
waren, hielt Hitler das Selbstbestimmungsrecht für
Deutschland entgegen. Um einer drohenden Isolation zu
entgehen, schloss Hitler außerdem Verträge (z.B. das
Konkordat zwischen dem deutschen Reich und dem Vatikan), die
vertrauensbildend wirken sollten.
Die anderen Länder nahmen die politische Umwälzung in
Deutschland zunächst ohne weiteres hin. Hitler führte 1935
die Wehrpflicht wieder ein und rüstete militärisch auf. Die
britische Regierung verhielt sich mit Premierminister
Chamberlain sehr zurückhaltend. Erste militärische Nahziele
Hitlers waren die Eroberungen von Österreich und der
Tschechoslowakei, um den Gewinn von Nahrungsmitteln
sicherzustellen. Nachdem Deutschland Österreich 1938
annektiert hatte, wurde die Sudetenkrise zum Brennpunkt des
internationalen Konflikts. Die Krise führte letztendlich zur
widerstandslosen Besetzung der restlichen Tschechoslowakei
durch Deutschland. Auf der Münchener Konferenz einigten sich
die europäischen Staatsmänner, Deutschland die Eingliederung
des Sudetenlandes zu gewähren. Schließlich wollten die
Briten einem erneuten Weltkrieg aus dem Weg gehen.
Im März 1939 besetzten Truppen der deutschen Wehrmacht
völkerrechtswidrig die „Rest-Tschechei". Diese Eroberung war
aus strategischen Gründen wichtig, da der langgezogene
Landstreifen weit nach Osteuropa führte. Für die
europäischen Großmächte war mittlerweile unmissverständlich
geworden, dass das NS-Regime keineswegs am Frieden in Europa
interessiert war. Nach der gewaltsamen Eroberung der
Tschechoslowakei entschlossen sich Großbritannien und
Frankreich dazu, dem vom Überfall bedrohten Polen
militärische Unterstützung zuzusagen.
Der nächste außenpolitische Schritt Hitlers sollte der Angriff auf Polen werden. Mit diesem Krieg wollte er vor allem Lebensraum im Osten schaffen.
Der 1. September 1939 und die Folgen

Warschau beim Beginn der Bomben- und Sturzkampfangriffe. Foto: Bundesarchiv, CC-BY-SA-3.0-de | Benno Wundshammer.
1.9.:
Deutscher Überfall auf Polen. Die deutsche Luftwaffe fliegt
bis zur polnischen Kapitulation schwere Bombenangriffe, die
Tausende Ziviltote fordern und schwere Zerstörungen
bewirken.
Frankreich und Großbritannien forderten ultimativ den
sofortigen Rückzug aller deutschen Truppen aus Polen.
Wiedereingliederung Danzigs in das Deutsche Reich; das
betreffende Gesetz war bereits vorher vorbereitet worden.
Ausgangssperre für Juden im Deutschen Reich.
2.9.:
Generalmobilmachung in Frankreich.
3.9.:
Die Botschafter Frankreichs und Großbritanniens übergeben in
Berlin die Kriegserklärungen ihrer Regierungen an das
Deutsche Reich.
Die Regierungen von Australien und Neuseeland erklären, es
sei ihre Pflicht, dem britischen Mutterland zu folgen und in
den Krieg gegen das Deutsche Reich einzutreten.
Führer und Reichskanzler Adolf Hitler erlässt die Weisung
Nr. 2 für die Kriegführung. Ziel bleibt der schnelle Sieg
über Polen. Gegenüber Großbritannien wird der Seekrieg nach
Prisenordnung
freigegeben, ansonsten soll die Initiative dem Gegner
überlassen werden.
Großbritanniens Premierminister Arthur Neville Chamberlain
bildet ein Kriegskabinett.
In Bromberg (Polen) werden mehrere tausend Volksdeutsche
ermordet.
Das deutsche Unterseeboot U 30 torpediert den britischen
Passagierdampfer "Athenia".
Reinhard Heydrich, Chef der Sicherheitspolizei und des
Sicherheitsdienstes der SS, veröffentlicht einen Runderlass
über "Grundsätze der
inneren Staatssicherung während des Krieges". Es ist u.a.
gegen jedermann einzuschreiten, der öffentlich am deutschen
Sieg zweifelt.
3./4.9.: Erste Flugblattabwürfe durch britische Maschinen auf das Rheinland und Ruhrgebiet. Die "Nickel raids" werden im Frühjahr 1940 bis nach Mittel- und Süddeutschland ausgedehnt.
17.9.:
Die sowjetische Armee überschreitet die polnische Grenze;
einen Tag später treffen sich in Brest deutsche und
sowjetische Truppen.
24. -
25.9.: Bei der Belagerung der
polnischen Hauptstadt Warschau durch Wehrmachtstruppen
fliegt die Luftwaffe mit 1.200 Maschinen schwere
Bombenangriffe auf das Stadtgebiet und besonders auch gegen
Wohnviertel.
27.9.:
Kapitulation Warschaus: die polnischen Verteidiger unter
General Juliusz Rómmel kapitulierten angesichts der rund
26.000 von deutschen Bomben und Artillerie getöteten
Zivilisten.
6.10.:
Kapitulation der letzten polnischen Truppenverbände. Hitler
macht den Westmächten ein Friedensangebot, das diese
ablehnen.
12.10.:
Bildung eines sogenannten Generalgouvernements aus den
besetzten polnischen Gebieten, die nicht dem Deutschen Reich
angegliedert wurden.
18.12.:
Bei einem Luftangriff auf Wilhelmshaven verliert das
britische Bomber Command fünf von 12 eingesetzten Maschinen.
Bis Sommer 1944 bleiben Angriffsoperationen des Bomber
Command bei Tageslicht auf Ziele in Deutschland eine
Ausnahme, da zu hohe Verluste befürchtet werden.
Zweiter Weltkrieg: Tag der Befreiung am 8. Mai 1945
Kriegszerstörungen in der Oranienstraße in Berlin. Foto: Bundesarchiv/CC-BY-SA 3.0
Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Als die Waffen endlich schwiegen, waren mehr als 60 Millionen Opfer zu beklagen. Nach zwölf Jahren nationalsozialstischer Herrschaft bedeutete dieser Tag den politischen, militärischen und moralischen Untergang des verbrecherischen Regimes in Deutschland, das die Welt in den Abgrund gestürzt hatte. Diese Seite bietet einen Überblick über das Kriegsende und den Zweiten Weltkrieg.
Deutschland 1945: Das „Tausendjährige Reich“ der Nationalsozialisten versank in Schutt, Blut und Tränen. Als am 8. Mai die Waffen endlich schwiegen, waren mehr als 60 Millionen Opfer zu beklagen. Gefallen im Krieg, ermordet in Konzentrationslagern, verbrannt in Bombennächten, gestorben an Hunger, Kälte und Gewalt auf großen Fluchtbewegungen. Nun erfuhr die Welt auch in vollem Umfang, was in deutschem Namen in den Vernichtungslagern des Regimes geschehen war.
Der Krieg ist Anfang April 1945 eigentlich entschieden. In Jalta beraten die USA, Frankreich, Großbritannien und die Sowjetunion Anfang Februar schon über eine Nachkriegsordnung. Aber statt aufzugeben, werfen die Nationalsozialisten immer noch alles, was verfügbar ist, in die letzte Schlacht. Alte Männer werden zum „Volkssturm“ eingezogen, Kinder der Hitlerjugend werden mit Panzerfäusten auf die Straßen geschickt. An vielen Orten im ganzen Reich werden zahlreiche Menschen noch als „Verräter“ hingerichtet. Bis zum Schluss fällen Standgerichte von Wehrmacht und SS tausende Todesurteile gegen deutsche Soldaten und Zivilisten. Am 21. April erreicht die Sowjetarmee die Stadtgrenze von Berlin, am Abend des 29. April 1945 stehen die russischen Soldaten am Brandenburger Tor. Erst am 2. Mai ist der Kampf um Berlin zu Ende.
Während Berlin im Straßenkampf unterging und zehntausende Menschen den Kampf bis zum bitteren Ende mit ihrem Leben bezahlen mussten, entzog sich Adolf Hitler am 30. April 1945 der Verantwortung durch Selbstmord. Zu seinem Nachfolger bestimmte er Großadmiral Karl Dönitz. Dönitz beauftragte Generaloberst Alfred Jodl, den Verantwortlichen für die Kriegführung von Norwegen bis Nordafrika, die Kapitulationsverhandlungen im amerikanischen Hauptquartier in Reims zu führen. Jodl versuchte noch, die Kapitulation gegenüber der roten Armee hinauszuzögern, um den Deutschen in den Ostgebieten die Flucht nach Westen zu ermöglichen, allerdings ohne Erfolg.
Generaloberst Jodl unterzeichnete am 7. Mai 1945 in Reims im Hauptquartier von General Dwight D. Eisenhower, Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Sie trat am 8. Mai 1945 um 23 Uhr in Kraft. Der sowjetische Diktator Josef Stalin drängte auf eine Wiederholung der Zeremonie im sowjetischen Machtbereich. In der Nacht zum 9. Mai unterschrieb Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, Chef des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht, die Kapitulationsurkunde im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst. Nach mehr als fünf Jahren Krieg schwiegen in Europa endlich die Waffen.
|
KAPITULATIONSERKLÄRUNG Original Kapitulationserklärung |
Am 5. Juni 1945 unterzeichneten die
vier Siegermächte die Berliner Deklaration. Darin heißt
es: „Die Regierungen des Vereinigten Königreichs, der
Vereinigten Staaten von Amerika, der Union der
Sozialistischen Sowjet-Republiken und die Provisorische
Regierung der Französischen Republik übernehmen hiermit
die oberste Regierungsgewalt in Deutschland,
einschließlich aller Befugnisse der deutschen Regierung,
des Oberkommandos der Wehrmacht und der Regierungen,
Verwaltungen oder Behörden der Länder, Städte und
Gemeinden.“
Deutschland wurde in vier Besatzungszonen und Berlin in
vier Sektoren aufgeteilt. Jede Siegermacht bestimmt in
ihrer Zone bzw. ihrem Sektor die wirtschaftliche und
politische Entwicklung nach seinem Ermessen.
Neubeginn: Die Potsdamer Konferenz
Der Krieg im Pazifik, der am 7.
Dezember 1941 mit dem japanischen Überfall auf Pearl
Harbor begonnen hatte, dauerte noch bis August 1945 und
erreichte mit den Atombombenabwürfen auf die Städte
Hiroshima und Nagasaki seinen traurigen Höhepunkt. Am 2.
September 1945 endete mit der Kapitulation Japans der
Zweite Weltkrieg auch im pazifischen Raum.
Die Bilanz des Zweiten Weltkrieges ist erschütternd:
Über 60 Millionen Menschen starben, mehr als sechs
Millionen europäische Jüdinnen und Juden wurden
ermordet. Hundertausende Sinti und Roma, politisch und
weltanschaulich Andersdenkende, Menschen mit Behinderung
oder Krankheit, Homosexuelle und weitere Minderheiten
wurden verfolgt und getötet. 17 Millionen Menschen waren
verschollen. Weite Teile Europas waren zerstört.
Blick auf Stuttgart am Ende des Zweiten Weltkrieges. Foto: LMZ
Der Holocaust, die systematische Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden sowie weiterer Bevölkerungsgruppen, war unter den Bedingungen dieses Krieges vollstreckt worden.
LpB-Dossier: 27. Januar 1945: Jahrestag der Befreiung von Auschwitz
Bereits in den letzten Kriegsmonaten begannen Flucht und Vertreibung von rund 14 Millionenn Deutschen in den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches.
LpB-Dossier: Flucht und Vertreibung
Mehr als die Hälfte der rund 5,7 Millionen Soldaten der Roten Armee, die im Zweiten Weltkrieg in deutsche Kriegsgefangenschaft gerieten, überlebten die mörderischen Bedingungen nicht.
Nach
Zwangsarbeit, Hunger und Krankheit kehrten nur knapp zwei Millionen
der 3,2 Millionen deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion
nach Deutschland zurück, die letzten im Januar 1956. Nach Angaben
des Deutschen Roten Kreuzes ist das Schicksal von 1,3 Millionen
deutschen Militärangehörigen bis heute ungeklärt.
Das Ende des Krieges war nicht die Ursache für Flucht, Vertreibung
und Unfreiheit. Die Ursache liegt vielmehr in seinem Anfang und im
Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Krieg führte. Der 8. Mai 1945
darf nicht vom 30. Januar 1933, dem Tag der Machtübergabe an Hitler,
getrennt werden (Richard von
Weizsäcker).
Zweiter Weltkrieg: Kriegsende in Baden-Württemberg
Das zerstörte Stuttgart im Jahr 1946: Blick vom Rathaus über die Altstadt zur Leonhardskirche. Foto: LMZ Baden-Württemberg
In den
sechs Jahren des Krieges waren mehr als 225.000
Wehrmachtsangehörige aus dem Südwesten und annähernd
40.000 Zivilpersonen umgekommen.
Neunzig Prozent der getöteten Zivilpersonen - deutlich
mehr als die Hälfte waren Frauen – und mehr als die
Hälfte der gefallenen Soldaten waren seit Januar 1944
vom Nazi-Regime regelrecht geopfert worden. Noch in den
letzten Kriegstagen war es zu sinnlosen
Verteidigungsgefechten und zu völlig unnötigen
Todesurteilen gegen Deserteure und einzelne Mutige
gekommen, die versucht hatten, dem grausamen Treiben
durch Zusammenarbeit mit den alliierten Truppen ein Ende
zu setzten.
Einzelne Städte wie
Freudenstadt, Waldenburg im Hohenlohischen, Neuenburg
und Breisach am Rhein waren noch in den letzten
Kriegstagen dem Erdboden gleichgemacht worden.
Insgesamt fielen die Zerstörungen im Südwesten recht
unterschiedlich aus: Generell waren die industriellen
Zentren und die Städte stärker betroffen als die
ländlichen Gebiete, generell auch hatte es die Mitte und
den Westen des heutigen Landes Baden-Württemberg stärker
getroffen als den Süden und den Osten.
Zu der schrecklichen Bilanz des Krieges zählen auch die
mehr als
10.000 deportierten deutschen Juden aus Baden,
Württemberg und Hohenzollern,
die dem Rassenwahn des NS-Regimes zum Opfer gefallen
waren. Von den annähernd 150 jüdischen Kultusgemeinden,
die vor dem „Dritten Reich“ im Südwesten existiert
hatten, gab es nach dem Krieg gerade noch sieben.
Der NS-Rassenwahn hatte in nur wenigen Jahren
vernichtet, was über Jahrhunderte gewachsen war: eine
lebendige und vielfältige jüdische Kultur als wichtiger
Bestandteil der südwestdeutschen Gesellschaft. Zu den
Opfern zählten auch über 10.000 Menschen, die in
Grafeneck im Zuge des NS-"Euthanasie“- Kranken- und
Behindertenmordes getötet worden waren. Zu erinnern ist
auch an tausende von Menschen aus den vom NS-Regime
besetzten europäischen Ländern, die im weit verzweigten
Außenlagersystem des NS-Terrors ihr Leben lassen
mussten.
Eine fast unvorstellbare Zahl von
rund einer halben Million Kriegsgefangenen und
Zwangsarbeitern kommt
hinzu, die in den Südwesten Deutschlands verschleppt
worden war. Die Zivilpersonen, die sich als
Zwangsarbeiter, Zwangsverschleppte und überlebende
KZ-Häftlinge außerhalb ihres Heimatstaates befanden und
die von den Alliierten nun als
„Displaced
Persons“
bezeichnet wurden, irrten in den zerstörten Städten oder
in den ländlichen Gegenden umher. Für viele von ihnen
war ihre Leidenszeit mit der Befreiung durch die
alliierten Truppen keineswegs beendet. Sie waren
ausgehungert, erschöpft und teilweise auch aggressiv –
es kam zu Plünderungen, Vergewaltigungen und Morden.
Ursprünglich sollten die „DPs“ bis zur Rückkehr in ihre
Heimat in „Sammelstellen“ betreut werden, aus denen aber
rasch „Lager“ mit Bewachung und Stacheldraht wurden. Im
heutigen Baden-Württemberg waren es rund 180.000
Menschen, darunter etwa 70.000 sogenannte „Ostarbeiter“,
die „repatriiert“ werden sollten. Viele kehrten zwar
wieder in ihre Heimat zurück, andere aber blieben in
Deutschland und lehnten die Rückkehr in den
stalinistischen Osten ab, wo sie als „NS-Kollaborateure“
erneute Verfolgung, „Sibirien“ oder gar den Tod zu
befürchten hatten.
Die einheimische Bevölkerung erlebte das Kriegsende mit
der Auflösung der staatlichen und militärischen Ordnung
in ganz unterschiedlicher Art und Weise. In nur etwas
mehr als einem Monat hatten Amerikaner und Franzosen
Baden, Württemberg und Hohenzollern erobert. Die
Erfahrung des Kriegsendes unterschied sich recht
deutlich, je nachdem, ob es in den jeweiligen Orten noch
zu Kampfhandlungen und gleichzeitigen Bombenangriffen
gekommen oder ob die Übergabe kampflos vonstatten
gegangen war. Dort, wo noch bis in die letzten Stunden
gekämpft wurde, war es ein Unterschied, ob die deutschen
Truppen aus Wehrmachtseinheiten bestanden oder ob es
sich um SS-Männer handelte, die in aller Regel
fanatischer agierten. Letztlich war es auch ein
bedeutender Unterschied, welche der beiden
Besatzungsmächte einmarschierte. Vor allem in den
Gebieten Badens und Württembergs, die von französischen
Truppen besetzt wurden, kam es zu massenweisen
Vergewaltigungen und Plünderungen.
Unmittelbar am Ende des Krieges
lebten rund eine Million Menschen auf dem Gebiet des
heutigen Baden-Württemberg, die sich nicht an ihrem
eigentlichen Wohnort aufhalten konnten – Ausgebombte
sowie Evakuierte aus anderen Reichs- und Landesteilen.
Sie alle versuchten, auf irgendeine Weise ihre Heimat zu
erreichen und stellten die Verantwortlichen angesichts
eines völlig daniederliegenden Verkehrssystems vor
riesige Herausforderungen.
Zehntausende von deutschen Soldaten, die in
Kriegsgefangenschaft geraten waren, sollten erst sehr
viel später heimkehren können.
Noch 1947/48 waren deutlich über 100.000 Männer aus dem
Südwesten von den alliierten Siegermächten in
Kriegsgefangenenlagern inhaftiert.
Ein Großteil davon konnte 1949 heimkehren, die Letzten
unter ihnen kamen erst im Januar 1956 aus der
Sowjetunion zurück.
Im Land der Besiegten mochten nur wenige den
Zusammenbruch als Befreiung vom Joch des
Nationalsozialismus empfinden: die dem Tode Geweihten,
Drangsalierten und Verfolgten des Regimes, die im
Verborgenen wirkenden Opponenten, wohl auch manch
Ausgebombter. Es bedurfte langer Jahre des Wandels, bis
die Kapitulation von der Mehrheit der Bevölkerung als
Befreiung akzeptiert wurde. Aber auch diejenigen, die
das Kriegsende als Niederlage sahen, waren von
existenziellen Sorgen und Zukunftsängsten geplagt. Noch
war für niemanden zu ahnen, dass die
Zusammenbruchsgesellschaft von 1945 inner halb weniger
Jahre eine starke wirtschaftliche Dynamik entfalten
sollte.
Mit der bedingungslosen Kapitulation der letzten
Regierung des Deutschen
Reiches mit dem Großadmiral Karl Dönitz als
Reichspräsidenten, vertreten
durch das Oberkommando der Wehrmacht, hatte das Deutsche
Reich und damit auch sein Verwaltungsaufbau zu
existieren aufgehört. Während die hohen NS-Funktionäre
in aller Regel geflüchtet waren oder Selbstmord begangen
hatten, waren zahlreiche Bürgermeister auf ihren Posten
geblieben. An ihnen und an den neu berufenen,
unbelasteten Stadtoberhäuptern lag es nun, unter der
Kuratel der Besatzungsmächte die dringlichsten Probleme
des Nachkriegsalltags zu bewältigen.
Die Deutschen waren in dieser Situation ein Volk ohne
Staat, aber eines mit Kommunen. So lange die
Länderverwaltungen nicht wieder funktionierten, mussten
und konnten die weitgehend intakt gebliebenen
Kommunalverwaltungen staatliche Aufgaben übernehmen.
Dies gelang nicht zuletzt aufgrund einer ganzen Reihe
herausragender Bürgermeister, die tatkräftig anpackten
und die die niedergeschlagene Bevölkerung motivieren
konnten. Hinzu kam, dass sich dort, wo Verfolgte des
NS-Regimes und Unbelastete zur Verfügung standen, eine
überaus engagierte Art der Bürgerinitiative bewährte,
die gemäß dem Imperativ
„Nie
wieder!“
und mit einem
antinationalsozialistischen Grundkonsens über die alten
Parteigrenzen hinweg funktionierte. Nicht zu
unterschlagen ist dabei, dass unter den Aktiven der
ersten Stunde nicht nur Sozialdemokraten, Liberale und
Zentrumsanhänger waren, sondern oft auch Kommunisten mit
einer KZ-Leidensgeschichte. Sie wurden als „normaler“
Bestandteil der deutschen Parteienlandschaft angesehen,
bis die KPD ihren Weg hin zur stalinisierten Kaderpartei
nahm.
Auch für die notgeplagte Bevölkerung war der kommunale
Zusammenhang der unmittelbare Orientierungsrahmen im
Alltag: bei der Sicherung der menschlichen
Grundbedürfnisse wie Ernährung, Wohnen,
Energieversorgung zum Heizen und Kochen sowie bei der
Trümmerbeseitigung und beim Wiederaufbau.
Heimatvertriebene und Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg
Zwischen 1939 und 1945 war die Bevölkerungszahl in Südwestdeutschland bedingt durch die Kriegshandlungen und aufgrund einer niedrigen Geburtenrate von etwa 5,5 Millionen Menschen auf etwas weniger als 5,1 Millionen zurückgegangen. Nach dem Krieg wuchs die Bevölkerung zumindest in manchen Landesteilen rasant, was nur zum geringeren Teil auf die nun ansteigende Geburtenrate, sondern vor allem auf die Bevölkerungsverschiebungen im Zuge der militärischen Niederlage Deutschlands zurückzuführen war.
Schon vor dem Kriegsende waren Menschen aus den
deutschen Ostgebieten vor der Sowjetarmee auch nach
Südwestdeutschland geflüchtet. Die Massentransporte der
Heimatvertriebenen kamen aber seit Herbst 1945 an. Auf der Potsdamer
Konferenz hatten sich die drei „großen" Siegermächte auf eine
vertragliche Regelung „zur ordnungsgemäßen Überführung deutscher
Bevölkerungsteile" geeinigt, wie die Vertreibung amtlich hieß. Sie
lösten damit eine Welle zwangsweiser Migration in bislang
unbekanntem Ausmaß aus, die die Aufnahmeländer völlig unvorbereitet
traf.
Die Unterbringung, Versorgung und Integration der Heimatvertriebenen
– wenig später auch der SBZ-Flüchtlinge – war eine der größten
Herausforderungen der Nachkriegszeit. Auch hier verlief die
Entwicklung regional sehr unterschiedlich: Die Franzosen, die an der
Potsdamer Konferenz nicht beteiligt waren, fühlten sich auch nicht
an die dort getroffenen Beschlüsse gebunden und verweigerten
zunächst die Aufnahme von Vertriebenen in ihrer Besatzungszone.
Nicht zuletzt fürchteten sie eine wirtschaftliche und politische
Destabilisierung der Nachkriegsgesellschaft. Entsprechend stagnierte
in den beiden französisch besetzten südwestdeutschen Ländern vorerst
auch die Bevölkerungszahl.
Bis 1949 war hier von einem „Flüchtlingsproblem" nicht zu sprechen: In (Süd-)Baden waren im Jahr 1946 lediglich etwa 20.000 „Alt-Evakuierte" und Flüchtlinge im Land, die vor Erlass der Zonensperre „eingesickert" waren. In Württemberg-Hohenzollern waren es 28.000 (vgl. Tabelle). Erst ab 1949/50 stiegen nun auch hier die Flüchtlingszahlen deutlich an, weil beide Länder im Rahmen des Länderflüchtlingsausgleichs der ersten Bundesregierung Kontingente aufnehmen mussten. Aufgrund der geringeren Wirtschaftskraft und damit geringerer Zuweisungen erreichten aber hier die Werte nie das Niveau der amerikanischen Zone.
Völlig anders gestaltete sich dagegen die Entwicklung im amerikanisch besetzten Württemberg-Baden: Innerhalb nur eines Jahres kamen hier seit Herbst 1945 über eine halbe Million „Flüchtlinge" an, wie sie von Amts wegen noch genannt wurden. Rund 321.000 waren es im weniger stark zerstörten Nordwürttemberg und 183.000 in Nordbaden. Schon im Sommer 1945 waren die zerstörten industriellen Zentren wie Ulm, Heilbronn, Stuttgart, Mannheim und Pforzheim als „Brennpunkte des Wohnungsbedarfs" für jeglichen Zuzug gesperrt worden. Um ein länger dauerndes „Lagerleben" zu verhindern, schrieb die US-Besatzungsmacht vor, dass die Vertriebenen möglichst rasch und unter Beibehaltung der Familien-, nicht aber der Dorfgemeinschaft über das Land zu verteilen und dafür privater Wohnraum der ansässigen Bevölkerung zu beschlagnahmen war.
Die Heimatlosen waren damit den Zufällen des behördlich organisierten Bevölkerungstransfers ausgeliefert. Sie kamen zunächst in staatliche Durchgangslager und wurden dann auf die orte ihrer „Erstplatzierung“ verteilt. In Nordwürttemberg erfolgte diese Verteilung relativ gleichmäßig, wobei der Anteil der Zwangszuwanderer an der Gesamtbevölkerung in den Landkreisen bei fast 18 Prozent und in den Stadtkreisen bei etwa fünf Prozent lag. Aufgrund der starken Kriegszerstörungen in den Landkreisen Bruchsal, Mannheim und Pforzheim mussten hier vor allem in den stärker landwirtschaftlich geprägten Kreisen Buchen, Mosbach, Sinsheim und Tauberbischofsheim zusammenrücken. Hier machten die Vertriebenen im Schnitt 23 Prozent der Bevölkerung aus, in einzelnen Kreisen gar fast dreißig Prozent. Die ökonomischen Rahmenbedingungen in den Kreisen, in denen die Vertriebenen „erstplatziert" wurden, bestimmten dann auch ganz entscheidend deren Start- und Integrationschancen.
Auf das gesamte Land Baden-Württemberg gesehen wurde der Höchststand der Zahl der Zwangszuwanderer erst 1961, im Jahr des Baus der Berliner Mauer, erreicht. Nun waren 1,2 Millionen Heimatvertriebene und weitere 415.000 SBZ-Flüchtlinge im Land. Zusammengenommen machten die „Neubürger", wie sie inzwischen amtlicherseits genannt wurden, fast 21 Prozent der gesamten baden-württembergischen Bevölkerung aus.
In vielerlei Hinsicht lässt sich die Integration der Zwangszuwanderer aus der ex post-Perspektive als Erfolgsgeschichte lesen. Weite Teile der Vertriebenen kamen mit Erfahrungen in der Landwirtschaft, aber auch mit fundierter handwerklicher oder anderer Ausbildung. In der deutschen Nachkriegsgesellschaft waren sie ein Aktivum, zumal die Industrie zusehends nach Arbeitskräften verlangte. Ohne das einsetzende Wirtschaftswunder wäre ihre Integration sicherlich problematischer verlaufen, aber ohne die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge wäre wiederum das Wirtschaftswunder kaum möglich gewesen.
Die „Neubürger" waren leistungs- und aufstiegsorientiert und versuchten, mit viel Fleiß und Ehrgeiz den sozialen Status wieder zu erreichen, den sie in ihrer Heimat gehabt hatten. Die rege Bautätigkeit der Vertriebenen, die vor allem mit dem Lastenausgleichsgesetz von 1952 einsetzte, war symptomatisch, denn das Eigenheim war auch hier soziales Leitbild und Symbol für das „Ankommen" in der bundesrepublikanischen Gesellschaft.
Allerdings ist der „Mythos der schnellen Integration" (Thomas Grosser) auch zu hinterfragen. Durch die zum Teil erheblichen Konfessionsunterschiede zwischen einheimischer und vertriebener Bevölkerung entstanden kulturell bedingte Konflikte und Vorbehalte, die nur langsam abgeschliffen werden konnten. Gerade im vorwiegend protestantischen Nordwürttemberg führte die Zuwanderung der überwiegend katholischen Vertriebenen zur größten Verschiebung der Konfessionsverhältnisse seit dem Dreißigjährigen Krieg. So blieb beispielsweise die Verbindung der Vertriebenen mit den Einheimischen durch Heirat auch wegen dieser konfessionellen Unterschiede vor allem in den ländlichen Gebieten lange Zeit die Ausnahme.
Hinzu kam, dass sich nach der wirtschaftspolitisch liberalisierenden Weichenstellung der Währungsreform auch die Konflikte um Arbeitsplätze, Bezahlung und Wohnraum deutlich verschärften. Zumindest zwischenzeitlich stieg bei den „Neubürgern" die Arbeitslosigkeit deutlich stärker an als bei der „einheimischen" Bevölkerung. Weitere sozialökonomische und sozialkulturelle Integrationsbarrieren sind zu nennen: Wohl gelang relativ rasch die Teilhabe am expandierenden Konsumgütermarkt, noch lange aber blieben deutliche Unterschiede bei der Vermögenssubstanz bestehen, an denen auch der Lastenausgleich nichts änderte, wenngleich er vielen Alteingesessenen als ungerecht erschien. Zwar sorgten Wohnungsbauprogramme dafür, dass die Heimatvertriebenen verhältnismäßig schnell ein eigenes Dach über dem Kopf hatten, doch wurde noch lange Zeit bei den Vertriebenen nicht die Wohneigentümerquote der „Altbürger" erreicht.
Quelle: Karl Moersch, Reinhold Weber: Die Zeit nach dem Krieg: Wiederaufbau in Südwestdeutschland. Landeskundliche Reihe Bd 37. Die Zeit nach dem Krieg: Städte im Wiederaufbau.
Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg
Die Potsdamer Konferenz
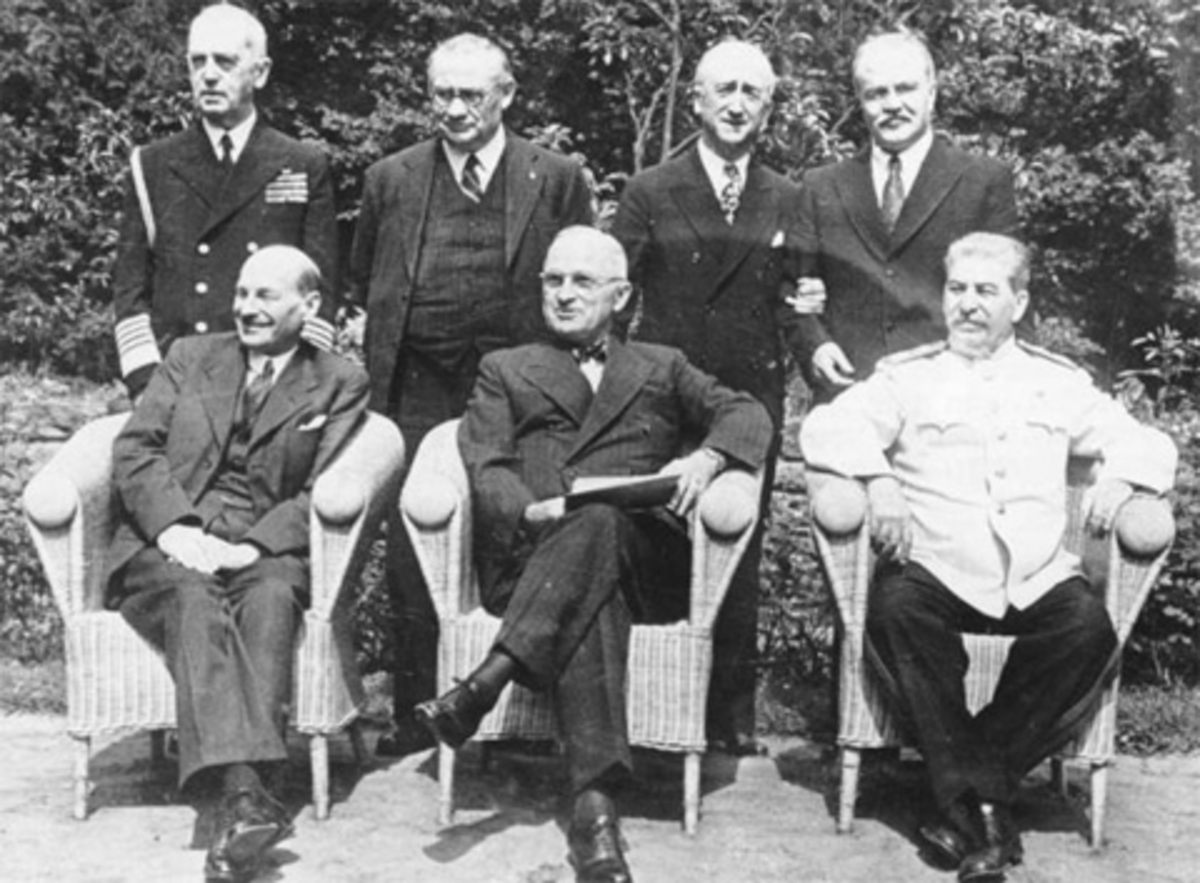
Potsdamer Konferenz der führenden Staatsmänner der drei alliierten Mächte der UdSSR, Grossbritannien und der USA vom 17. Juli bis 2. August 1945 in Schloß Cecilienhof und Babelsberg. v.l.n.r.: sitzend: C.R. Attlee, H.S. Truman, Josef Stalin; stehend: Admiral J.D. Loahy, E. Bevin, J.W.Byrnes, und W.M. Molotow. Foto: Bundesarchiv, Bild 183-R86965. CC-BY-SA.
1945 herrschte in Deutschland Zerstörung, Hunger, Hoffnungslosigkeit und Chaos vor. Die Infrastruktur war fast komplett vernichtet, Wohngebiete teilweise ausgelöscht, besonders das Transportwesen hatte es hart getroffen. Großstädte wie Köln und München waren kaum mehr zu erkennen. Die meisten Brücken über den großen Flüssen waren eingebrochen, die Verkehrsadern gelähmt. Millionen Menschen mussten längere Zeit auf Wasser, Gas und Elektrizität verzichten. Die Menschen hatten riesige Trümmerberge aufzuräumen, ihr Existenzminimum zu sichern und die Vergangenheit zu bewältigen. Von 1945 bis zur Währungsreform 1948 und der Rückkehr der Kriegsgefangenen ersetzten die „Trümmerfrauen" fehlende männliche Arbeiter im Baugewerbe.
Über zwölf Millionen deutsche Flüchtlinge und Vertriebene sowie bis zu zwölf Millionen "Displaced Persons" – ehemalige Zwangsarbeiter und ausländische KZ-Insassen – mussten nach dem Ende des Krieges eine neue Heimat finden bzw. repatriiert werden. Flucht und Vertreibung aus den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reichs hielten bis lange nach Kriegsende an und forderten zwischen 1944 und 1947 bis zu 600.000 Menschenleben. Amtliche Zahlen aus den 1950er Jahren gingen von ca. zwei Millionen Toten aus, halten einer Überprüfung aber nicht stand.
Am Ende des Zweiten Weltkriegs gab es mehr als acht Millionen Deutsche, die sich als Kriegsgefangene im Gewahrsam der Siegermächte befanden. Im ersten Jahr nach Kriegsende wurden fünf Millionen von ihnen entlassen. Viele Menschen wurden vermisst, ihr Verbleib konnte nicht geklärt werden. 1950 sprach man von 1,3 Millionen Vermissten im Osten und 100 000 Vermissten im Westen, der Suchdienst des Roten Kreuzes hat 1,086 Millionen deutsche Soldaten schließlich für tot erklärt.
Die industrielle Produktion in Deutschland war praktisch zum Erliegen gekommen. Teilweise konnte die Nahrungsmittelversorgung nur durch umfangreiche internationale Hilfslieferungen auf extrem niedrigem Niveau gesichert werden. Die Reichsmark war kaum mehr etwas wert. Sie hatte ihre Rolle als Tausch- und Zahlungsmittel weitgehend verloren. Anstatt in Währung tauschten die Menschen nun hauptsächlich in Naturalien. Der „Schwarze Markt" entwickelte sich explosionsartig. Denn angesichts der relativen Wertlosigkeit von Geld und Lebensmittelkarten sah sich der "Normalverbraucher" auf Schwarzhändler und Schieber angewiesen. Auf dem offiziellen Markt des Rationierungssystems gab es bei weitem nicht das Lebensnotwendige. Mit sogenannten „Hamsterfahrten" aufs Land sicherte sich die städtische Bevölkerung ihr Überleben. Dabei tauschte sie Hausrat, Kleidung oder Wertgegenständen gegen Lebensmittel. Wichtigstes Zahlungsmittel waren aber Zigaretten, für die man auf dem Schwarzen Markt fast alles erhalten konnte.
Die Politik der Siegermächte
Mit der Berliner Deklaration vom 5. Juni 1945
übernahmen die vier Siegermächte, USA, Sowjetunion, Großbritannien
und Frankreich, die Oberste Regierungsgewalt in Deutschland. Der aus
den vier Oberbefehlshabern gebildete Alliierte Kontrollrat in Berlin
entschied fortan über alle Fragen, die Deutschland als Ganzes
betrafen. Das Deutsche Reich wurde in vier unterschiedlich große
Besatzungszonen und Berlin in vier Sektoren aufgeteilt, in denen die
Militärgouverneure nach eigenem Ermessen handeln.
Auf der Potsdamer Konferenz (17. Juli - 2. August 1945) einigten
sich die vier Siegermächte auf politische Grundsätze für die
Behandlung Deutschlands:
Entmilitarisierung, Entnazifizierung, Dezentralisierung, Dekartellisierung und Demokratisierung. Außerdem wurde beschlossen, die deutschen Gebiete östlich von Oder und Lausitzer Neiße bis zu einem Friedensvertrag unter polnische sowie sowjetische Verwaltung zu stellen und die dortige deutsche Bevölkerung ebenso wie die Deutschen aus der Tschechoslowakei und Ungarn auszusiedeln.
Die Zukunft Deutschlands war in den ersten
Nachkriegsjahren noch ungewiss. Die langwierigen Verhandlungen der
Besatzungsmächte zeigten immer deutlicher den beginnenden Kalten
Krieg zwischen den Supermächten USA und UdSSR. In der ehemaligen
Hauptstadt Berlin spiegelte sich der Konflikt im Kleinen und spitzte
sich zu. Ihre Teilung nach der sowjetischen Blockade 1948 war ein
Vorbote der Gründung zweier deutscher Staaten.
Nach fast einem Jahr Verhandlungsdauer wurden am 1. Oktober 1946 12
der 24 Hauptkriegsverbrecher im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess
zum Tode verurteilt und hingerichtet.
Bei Kriegsende führte die NSDAP-Kartei 6,5 Millionen Mitglieder. Vor allem die Staatsdiener waren eng mit der Nazi-Herrschaft verbunden. Über 65 Prozent der Beamten, mehr als 80 Prozent aller Richter und Justizbeamten waren Parteigenossen. Der NS-Lehrerbund meldete 491.000, der Ärztebund 72.000 Gefolgsleute. Es war die breite deutsche Mitte, die sich Hitler und seiner Politik verschrieben hatte. Die Sowjets zielten vor allem auf die Entmachtung der politischen Führungsschicht. Bereits Ende 1947 proklamierte die sowjetische Militärregierung das Ende der politischen Säuberung. Nach der gesellschaftlichen Umwälzung, nachdem rund 520.000 Personen von ihrem Posten entfernt worden waren, sah die neue Staatsmacht keinen Grund mehr, auf die Mitarbeit von Nazis zu verzichten.
Am 30. Juni 1949, kurz nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland, präsentierte die amerikanische Militärregierung ihre Entnazifizierungsbilanz, nach der 99 Prozent aller Fälle abgeschlossen waren. Die Zahl der nach dem "Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus" erfassten Personen belief sich auf über 13 Millionen. Gegen rund 3,5 Millionen war Anklage erhoben worden, etwa 2,5 Millionen waren ohne Verfahren amnestiert worden. Die Spruchkammern erledigten 950.000 Fälle. Dabei wurden nur 1.654 Altnazis als "Hauptschuldige" eingestuft und verurteilt. Und eines der ersten Gesetze, das der Deutsche Bundestag 1949 erließ, war das einstimmig verabschiedete Amnestiegesetz. 1954 folgte die zweite Bundesamnestie, nach der die große Mehrheit der verurteilten NS-Täter begnadigt und die Urteile aus dem Strafregister gelöscht wurden.
Je länger sich in den Westzonen die Verfahren hinschleppten, desto mehr entwickelten sich die Spruchkammern zu wahren "Mitläufer"-Fabriken. Wechselseitig stellten sich alte Nazis "Persilscheine" aus und schafften es millionenfach, sich als verführte Unschuldige aus der Affäre zu mogeln. Als wäre nichts geschehen, kehrten NS-Spitzenleute auf ihre Posten zurück - nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien und Wissenschaft.
Vier Jahre nach Kriegsende, am 8. Mai 1949, beschloss der Parlamentarische Rat das Grundgesetz. Über Parteigrenzen hinweg gaben seine Demokraten die Antwort auf Krieg und Gewaltherrschaft in Artikel 1 unserer Verfassung:
(2) Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
Textquelle: Internetprojekt LeMO (Lebendiges virtuelles Museum Online) des Deutschen Historischen Museums in Berlin und des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn.
Die Nürnberger Prozesse

Anfang August 1945 begründeten die Alliierten einen Internationalen Militärgerichtshof zur Verurteilung von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen gegen den Frieden. Der Militärgerichtshof sollte im Justizpalast Nürnberg tagen. Die Nürnberger Prozesse gelten als der wichtigste Bestandteil des alliierten Bestrafungsprogramms gegen führende Vertreter des NS-Regimes. Sie fanden vom 20. November 1945 bis 14. April 1949 statt und umfassten den Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher sowie mehrere sogenannte Nürnberger Nachfolgeprozesse.
Der Zweite Weltkrieg
Der Krieg weitete sich 1940 auf Nord- und Westeuropa aus. Während Dänemark kampflos kapitulierte, leistete Norwegen vor der Kapitulation vom 10. Juni heftigen Widerstand. Der deutsche Angriff auf die Niederlande, auf Belgien, Luxemburg und Frankreich hatte bereits am 10. Mai 1940 begonnen. Mit dem Kriegseintritt Italiens, das mit Deutschland verbündet war, wurden der Mittelmeerraum und Teile Afrikas ab Juni 1940 ebenfalls zum Kriegsschauplatz. Am 22. Juni 1941 begann der Vormarsch von deutschen Divisionen gegen die Sowjetunion.
Beginn der europäischen Integration im Zeichen des Kalten Krieges

Stuttgart nach Ende des Krieges 1946. Im Vordergrund: Das Stuttgarter Rathaus. Foto: LMZ Baden-Württemberg.
Trotz anhaltend niedriger Wahlbeteiligung
und Zunahme von europaskeptischen und
rechtspopulistisch-nationalistischen Parteien bei den
Europawahlen 2014 gilt die europäische Einigung und die
Herausbildung der Europäischen Union nach wie vor den
meisten der rund 500 Millionen EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern
als wichtiger Meilenstein in der Entwicklung dieses von
Krisen und Kriegen geschüttelten Kontinents. Das
Nobelpreiskomitee in Stockholm hat nicht umsonst im Jahre
2012 der EU deshalb für ihre friedens- und
freiheitssichernde Funktion den Friedensnobelpreis vergeben.
Allerdings wachsen derzeit die Ansprüche an die EU rasant.
In Konkurrenz mit den USA und den asiatischen Großräumen
soll die EU die Zukunftsfähigkeit des "alten Kontinents"
ermöglichen, soll neue Wachstumskraft und
Innovationspotenzial generieren, um im globalen
ökonomischen, ökologischen und sozialen Konkurrenzkampf
langfristig zu bestehen. Sogar bei den Europa-Enthusiasten
droht aktuell Ernüchterung, ja Enttäuschung um sich zu
greifen. Der Europäische Einigungsprozess befindet sich –mal
wieder – in der Krise. Er drohe, so der gerade
wiedergewählte Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz,
gar zu scheitern. In die Kritik geraten dabei häufig die
Institutionen und komplexen Entscheidungsprozesse innerhalb
der Europäischen Union, denen nachgesagt wird, nur sehr
schwerfällig und überbürokratisch zu agieren. Nicht selten
werden die Brüsseler Strukturen gar als "Moloch" denunziert.
Übersehen wird dabei häufig, dass insbesondere diese
Institutionen historische Ursachen haben. Aus
unterschiedlichen nationalen aber auch einer europäischen
Perspektive werden die Nachkriegsjahre bis zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) im Jahre 1957
rekonstruiert. Von Anfang an gab es dabei ein Ringen von
nationalen Souveränitätsansprüchen, von Ansätzen
gouvernementaler Kooperation und sogar von Bestrebungen,
neue supranationale Strukturen in Europa zu schaffen.
Stunde Null oder Befreiung vom Faschismus?
Heute wird der militärische Sieg über die nationalsozialistische Herrschaft in großen Teilen von Europa durch die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg fast durchweg als "Befreiung vom Nationalsozialismus" bezeichnet. Allerdings überwogen in der Bundesrepublik Deutschland der unmittelbaren Nachkriegszeit zunächst überwiegend Begriffe wie "Zusammenbruch" oder "Stunde Null", die eher auf die materielle Not, die Zerstörungen, die Demontagen, Flucht und Vertreibung sowie den Aspekt des Neuanfangs verwiesen. In der DDR wurde an den 8. Mai 1945 dagegen von Anfang an als Tag der Befreiung gefeiert. Die DDR beanspruchte für sich, von Anfang an antifaschistisch aufgestellt gewesen zu sein, weswegen sie auch keine Verantwortung für die nationalsozialistischen Gräueltaten zu übernehmen bereit war. Dies stieß bei vielen Nachbarn Deutschlands auf Unverständnis.
Der Wandel im Westen wurde insbesondere durch eine Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 anlässlich des 40. Jahrestages des Kriegsendes in Europa eingeleitet. Nicht mehr Kapitulation und Niederlage, sondern die Beendigung der Diktatur wird seither in den Mittelpunkt des Gedenkens gestellt, obwohl von Weizsäcker in seiner Rede durchaus auf die Zwiespältigkeit des Jahrestages hinwies:
"Wir Deutschen begehen den Tag unter uns, und das ist notwendig. […] Wir brauchen und wir haben die Kraft, der Wahrheit, so gut wir es können, ins Auge zu sehen, ohne Beschönigung und ohne Einseitigkeit. […] Der 8. Mai ist für uns Deutsche kein Tag zum Feiern. Die Menschen, die ihn bewusst erlebt haben, denken an ganz persönliche und damit ganz unterschiedliche Erfahrungen zurück. Der eine kehrte heim, der andere wurde heimatlos. Dieser wurde befreit, für jenen begann die Gefangenschaft."
Kalter Krieg und Marshall-Plan-Hilfen
Eine zentrale Rolle für die westeuropäische Integration spielten nach 1945 nicht nur die politischen Umstürze und Gleichschaltungen in den von der sowjetischen Armee besetzten Gebieten in Mittel- und Osteuropa, sondern auch die von den USA als Wiederaufbauprogramm formulierte "Marshall-Plan-Hilfe". Das "European Recovery Program" (ERP) war ein Wirtschaftswiederaufbauprogramm der USA, das nach dem Zweiten Weltkrieg dem an den Folgen des Krieges leidenden Westeuropa zugute kam, prinzipiell aber auch den osteuropäischen Staaten angeboten wurde. Es bestand, vereinfacht ausgedruckt, aus Krediten, Rohstoffen, Lebensmitteln und Waren, vor allem aus den USA. Das 12,4-Milliarden-Dollar-Programm wurde am 3. April 1948 vom Kongress der Vereinigten Staaten verabschiedet und noch am selben Tag von US-Präsident Harry S. Truman in Kraft gesetzt. Im gesamten Zeitraum (1948–1952) leisteten die USA bedürftigen Staaten der "Organisation for European Economic Cooperation" (OEEC) Hilfen im Wert von insgesamt 13,1 Milliarden Dollar. Die Sowjetunion und die osteuropäischen Staaten wurden ebenfalls zu den Beratungen über die Hilfe der USA eingeladen. Sie zogen sich jedoch bald daraus zurück und verboten den osteuropäischen Staaten, die unter ihrem Einfluss standen, sogar jede Teilnahme, auch der vor 1948 noch demokratisch regierten Tschechoslowakei.
Der Auslöser für die Entscheidung, die europäischen
Länder einschließlich Deutschland zu unterstutzen, war
der beginnende Kalte Krieg. Als Reaktion u. a. auf den
Bürgerkrieg in Griechenland verkündete Truman am 12.
Marz 1947 die Truman-Doktrin, nach der die USA alle
"freien Volker" im Kampf gegen totalitäre
Regierungsformen unterstutzen wurden. Griechenland war
den Beschlüssen der Kriegskonferenzen zufolge britisches
Einflussgebiet. Trotzdem unterstutzte die Sowjetunion
offen die dortigen Kommunisten im Bürgerkrieg. Schon vor
der Bekanntgabe des Marshallplanes gab es Plane zum
Wiederaufbau Europas. US-Außenminister James F. Byrnes
präsentierte in einer Rede in Stuttgart am 6. September
1946 z. B. bereits eine frühe Version des Planes.
1945 und heute: Folgen des Zweiten Weltkriegs
Deutschland-Flagge. Bild: Flickr. János Balázs. CC BY-SA 2.0.
Der Zweite Weltkrieg hat seine
Spuren in der deutschen Geschichte hinterlassen und wirkt noch bis in die
Gegenwart hinein. Egal ob Orte, Gefühle, oder Politik - das Kriegsende
begleitet uns auch heute.
Seit 1945 hat Deutschland einige geschichtliche Marksteine auf seinem Konto.
Aufbau, Nachkriegsjahre, Wirtschaftswunder, Kalter Krieg, Bau und Fall der
Mauer und schließlich das Ende der DDR. Dabei konnte sich das Land zu einer
Wirtschaftsmacht entwickeln und eine Vorreiterrolle in Europa einnehmen.
Diese Entwicklung war stets begleitet von den Anstrengungen der jeweiligen
Regierung für die Grundwerte Freiheit, Demokratie und die Geltung der
Menschenrechte und für die europäische Einigung. Heute ist Deutschland von
Freunden und Partnern in Europa umgeben. Eine Umfrage während der
Fußball-Weltmeisterschaft 2014 besagte sogar,
die Bundesrepublik sei die beliebteste Nation der Welt.
Noch Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren die meisten
Deutschen weit davon entfernt, ihr Land als Aushängeschild zu sehen oder
sich mit ihm zu identifizieren. Der jüngeren, hauptsächlich westdeutschen
Bevölkerung mangelte es im Vergleich mit anderen europäischen Staaten - an
Nationalbewusstsein. Die Identifikation der Deutschen mit der eigenen Nation
erstarkte erst nach und nach, ausgelöst durch die friedliche
Wiedervereinigung, später bei europäischen und internationalen
Sportwettbewerben. Spätestens seit der Fußballweltmeisterschaft 2006
schwenken Deutsche ihre Nationalflagge wieder ganz ungehemmt in der
Öffentlichkeit. Sie singen selbstbewusst die Nationalhymne - etwas, das
vielen vorher noch befremdlich war.
Die Kriegsschuld Deutschlands
wirkte sich nicht nur sichtbar auf das Bewusstsein der Bundesbürger, sondern
auch auf die deutsche Politik aus. Lange nahmen deutsche Regierungen eine
eher zurückhaltende und wiedergutmachende Rolle auf internationalem Parkett
ein. Deutschland war nach 1945 von den auferlegten Beschränkungen der
Westalliierten geprägt. Die deutsche Außenpolitik war in den
Nachkriegsjahren durch Konrad Adenauers Leitlinie „Souveränitätsgewinn
durch Souveränitätsverzicht“ charakterisiert. Indem die noch junge
Bundesrepublik auf Souveränität verzichtete, gewann sie langfristig – nicht
zuletzt durch die Westbindung – an Souveränität. Man wollte keine neue Angst
bei den internationalen Partnern schüren und der Vergangenheit entschieden
entgegentreten, indem man sich mit ihr auseinandersetzte.
Der Bundesrepublik gelang es jedoch mit einer
verantwortungsvollen Politik, ihren Schatten aus der NS-Vergangenheit
abzuschütteln. Der ehemalige Erzfeind Frankreich gilt spätestens seit dem
Vertrag von Elysée von 1961 als enger Freund. Trotz des schrecklichen
Holocaust, der Deutschland eine besondere Verpflichtung und Verantwortung
gegenüber Israel auferlegt, sind auch diese beiden Länder heute
freundschaftlich, politisch und wirtschaftlich eng miteinander verbunden.
Das Nachbarschaftsverhältnis mit Polen entlang der Oder-Neiße-Grenze ist ein
gutes.
Deutschland spielt heute eine starke Rolle in Europa. Zum einen als
Wirtschaftsmacht, aber auch als einflussreicher politischer Protagonist in
der Außenpolitik. Mit einem neuen Selbstbewusstsein hat sich die Bundeswehr
von einer reinen Verteidigungsarmee in den letzten Jahren zu einer Armee im
Einsatz entwickelt. Presseberichte aus dem Ausland spiegeln regelmäßig
Bedenken über diese mächtige Stellung des ehemaligen Nazi-Deutschlands im
europäischen Gefüge.
Auch rechtsextremistische Auswüchse oder Europa-feindliche
Positionen, die in Deutschland wieder vermehrt Einzug halten, lassen
international aufmerken. Die britische BBC reagierte zum Beispiel schockiert
über die PEGIDA-Demonstrationen in Dresden. Hier sei sehr schnell klar
geworden, dass sich die Proteste gegen Asylbewerber richteten und nicht
gegen Islamisierung. Vor einigen Jahren wären solche Szenen in diesem Land
unvorstellbar gewesen, hieß es von der BBC.
Währenddessen ist der Zweite Weltkrieg für ältere Deutsche immer noch Teil
ihres Alltags. Viele leiden an den Spätfolgen des Krieges. Einer
Studie des Uniklinikums Leipzig zufolge häufen sich Posttraumatische
Belastungsstörungen im Alter besonders in Deutschland. Die ständige Angst
vor Bomben¬angriffen und erlittenen Vertreibungen, Erlebnisse aus einer
Inhaftierung oder Schreckensbilder aus Kampfhandlungen haben sich fest in
der Seele der Kriegsgeneration eingebrannt. An sich völlig harmlose Dinge
aus dem Alltag, bestimmte Orte, Aktivitäten, Gerüche oder Geräusche, können
dazu führen, dass die Betroffenen das Trauma in Bildern und Gefühlen erneut
durch¬leben. Depressionen, Schlafstörungen, Ängste,
Konzentrationsschwierigkeiten und sozialer Rückzug können die Folgen sein.

Aber auch konkret fassbare Überreste des Krieges
tauchen dann und wann auf. Immer wieder stoßen Experten auf alte Bomben aus
der Kriegszeit. Zehntausende sollen noch unter deutschem Boden liegen. Jedes
Jahr sprengen und entschärfen die Räumdienste der Bundesländer rund 5.000
Weltkriegsbomben. Weniger gefährlich, dafür umso wertvoller war ein Fund aus
dem Jahr 2012. Verschollen geglaubte NS- Kunstschätze kamen ans Tageslicht.
Cornelius Gurlitt aus München-Schwabing, Sohn des Kunsthändlers Hildebrand
Gurlitt (1895–1956), hatte hunderte Bilder, die unter NS-Raubkunstverdacht
stehen, in seiner Wohnung gehortet.
Dabei scheint es, als ob das allgemeine Wissen über das Kriegsende langsam
weniger wird. Nach einer Umfrage im Auftrag des Magazins Stern wussten schon
vor fünf Jahren 45 Prozent der Bundesbürger nicht, was am 8. Mai 1945
geschah. Besonders groß war die Unwissenheit unter den Jüngeren: Mehr
als zwei Dritteln (68 Prozent) der 18- bis 29-Jährigen ist laut Umfrage
nicht bekannt, dass an dem Tag der Zweite Weltkrieg beendet wurde.
An deutschen Lehr- und Bildungsplänen kann das nicht liegen. Darin ist der
Zweite Weltkrieg fester Bestandteil. Schüler und Schülerinnen sollen die
nationalsozialistische Vergangenheit beurteilen können und ein Bewusstsein
für die historische Verantwortung Deutschlands entwickeln, die sich aus der
NS-Vergangenheit ergibt.
Um der historischen Verpflichtung Deutschlands Rechnung
zu tragen, fördern Bund und Länder Gedenkstätten und entsprechende
Initiativen. Die Bundesregierung trägt mit der Gedenkstättenkonzeption dazu
bei, unter Wahrung der grundsätzlichen Zuständigkeit der Länder und
Kommunen, geeignete Rahmenbedingungen für die Gedenkstättenarbeit zu
schaffen. Ziel der Gedenkstätten ist es, Verantwortung wahrzunehmen, die
Aufarbeitung zu verstärken und das Gedenken zu vertiefen. Sie sollen mit
Forschungsarbeiten, Dokumentationen, Ausstellungen, Veröffentlichungen und
Veranstaltungen ihren spezifischen Anteil zur Darstellung der Orts-,
Regional- und Landesgeschichte während der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft leisten. Viele Menschen in Deutschland engagieren sich
ehrenamtlich für die Gedenkstättenarbeit. Sie schaffen damit einen
grundlegenden und unverzichtbaren Beitrag zum bewussten Umgang mit der
Geschichte und zur Demokratieerziehung.
Die Gedenkfeiern zum Kriegsende am 8. Mai 1945 sollen schließlich jedes Jahr
an Frieden und Freiheit erinnern und jeden Einzelnen mahnen, sich gegen
Gewalt und Diktatur abzugrenzen.
Zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft hat der unlängst verstorbene
ehemalige Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985
eine Rede gehalten, die wohl zu den bedeutenden Ereignissen in der
Geschichte Deutschlands gehört.
„Bei uns ist eine neue Generation in die
politische Verantwortung hereingewachsen. Die Jungen sind nicht
verantwortlich für das, was damals geschah. Aber sie sind verantwortlich für
das, was in der Geschichte daraus wird. Wir Älteren schulden der Jugend
nicht die Erfüllung von Träumen, sondern Aufrichtigkeit. Wir müssen den
Jüngeren helfen zu verstehen, warum es lebenswichtig ist, die Erinnerung
wachzuhalten." (Richard von Weizsäcker)
Beziehung Deutschland-Polen

Bronzetafel am Denkmal des Kniefalls in Warschau.
Das Auswärtige Amt bezeichnet Polen heute als einen zentralen Partner Deutschlands in der Europäischen Union. Die deutsch-polnischen Beziehungen seien für beide Seiten von herausgehobener Bedeutung. Sie hätten seit 1989 eine in der jüngeren Geschichte einmalige Dynamik entwickelt. Wie wertvoll dieses gute Verhältnis beider Länder ist, wird deutlich, blickt man auf den 1.9.1939 und die darauffolgenden Kriegsjahre zurück. Die Gräueltaten der Nationalsozialisten an der polnischen Bevölkerung von damals bleiben nach wie vor unvergessen.
Nach dem Überfall der deutschen
Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939 und dem Einfall der
Roten Armee an der Ostgrenze, brach eine schwere Zeit für
Polen an. Am 6. Oktober kapitulierten die letzten polnischen
Einheiten. Im Herbst 1939 teilten Deutschland und die
Sowjetunion das polnische Staatsgebiet unter sich auf.
Hitler konnte nun ohne Rücksicht seine expansive
"Lebensraum-Politik" in den westlichen Gebieten Polens
verfolgen. Der mittlere Teil Polens wurde deutsches
"Nebenland", also unmittelbar abhängiges Land. Diese
nationalsozialistische Politik kostete im Herbst 1939 bis zu
zwanzigtausend Mitgliedern der politischen und geistigen
Elite Polens das Leben. Gleichzeitig zwangen die
Nationalsozialisten die Menschen in Polen zur Umsiedlung
oder vertrieben sie. Die nationalsozialistischen Machthaber
wollten die jüdische Bevölkerung in den neuen Ostgebieten
vollständig vernichten. Dazu errichteten sie Arbeits-
und Konzentrationslager.
Wegen der Brutalität der deutschen Besatzer formierte sich
polnischer Widerstand. Als im April 1943 die letzten 60.000
Juden aus Warschau in Lager deportiert werden sollten, gab
es im Warschauer Ghetto einen
Aufstand. Die Wehrmacht schlug diesen
allerdings blutig nieder. Ein weiterer Aufruhr in Warschau
fand nach acht Wochen im Oktober 1944 ebenfalls ein Ende.
Daraufhin zerstörten die Nationalsozialisten die polnische
Metropole bis auf ihre Grundmauern.
Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs übernahm eine
provisorische polnische Regierung die Verwaltungsarbeit über
die Gebiete, die sich zwischen der
Oder-Neiße-Grenze und der Curzon-Linie
befanden. Rund 7 Millionen Deutsche mussten aus den
ehemaligen deutschen Gebieten flüchten. Etwa 1,5 Millionen
Polen mussten die ehemaligen polnischen Ostgebiete
verlassen.
In den ersten zwei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg
gab es keine offiziellen Kontakte zwischen dem westdeutschen
Staat und Polen. Die Folgen des Krieges wirkten nach. Ein
erhebliches Problem stellte die
Grenzfrage zwischen Polen und
Deutschland dar. 25 Jahre nach Kriegsende, am 7. Dezember
1970 unterzeichneten beide Länder schließlich den "Vertrag
über die Grundlagen der Normalisierung der gegenseitigen
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Volksrepublik Polen". Anlässlich der Unterzeichnung dieses
Vertrags kniete der damalige Bundeskanzler Willy Brandt in
Warschau vor dem Denkmal für die Opfer des Warschauer
Ghettoaufstands im April 1943 nieder. Der Kniefall
wurde als ein symbolischer Akt der Reue für die deutschen
Verbrechen auch an den nichtjüdischen Polen empfunden. In
der Folge belebten sich die kulturellen, politischen,
wirtschaftlichen und zwischenmenschlichen Kontakte zwischen
Deutschland und Polen.
Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion kam es schließlich zu
einem Neubeginn der deutsch-polnischen Beziehungen. Der
sechs Wochen nach der
Wiedervereinigung abgeschlossene deutsch-polnische
Grenzvertrag vom 14. November 1990 besiegelte
völkerrechtlich endgültig das Ende der Nachkriegszeit im
deutsch-polnischen Verhältnis.
Antikriegstag
Seit 1957 wird am 1. September an die Schrecken des Ersten und Zweiten Weltkriegs sowie an die schrecklichen Folgen von Krieg, Gewalt und Faschismus erinnert. Die Initiative für diesen Gedenktag ging vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) aus, der erstmals am 1. September 1957 unter dem Motto „Nie wieder Krieg“ zu Aktionen aufrief.
Materialien der Landeszentrale
-
Die
Reihe MATERIALIEN
Texte und Unterrichtsmaterialien zur Gedenkstättenarbeit - Gedenkstätten in Baden-Württemberg (Webauftritt des Fachbereichs Gedenkstättenarbeit)
Alte Fotos vom Krieg in Luxemburg